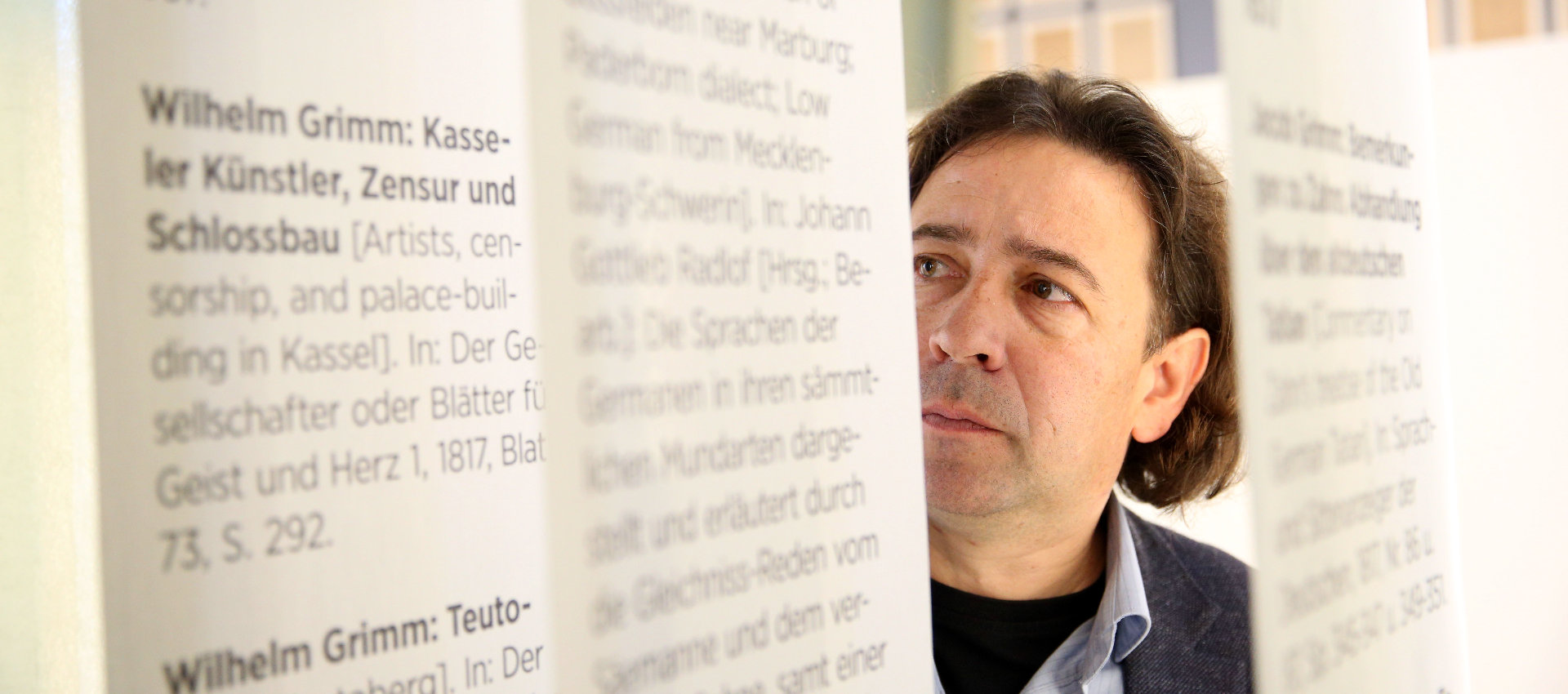Hinter der Rückgabe eines Kunstwerkes an Erben von NS-Opfern stecken oft bewegende Geschichten. Diese künftig zu erzählen, ist das Ziel eines neuen Erinnerungsprojektes.

Die Erforschung von verfolgungsbedingtem Kunstraub während des „Dritten Reiches“ wird seit vielen Jahren vorangetrieben. Das neue Erinnerungsprojekt „Kunst, Raub und Rückgabe – vergessene Lebensgeschichten“ von SPK und Bayerischen Staatsgemäldesammlungen nimmt nun die bewegenden Geschichten hinter den Restitutionsfällen in den Blick. Petra Winter, Direktorin des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin, und Andrea Bambi, Leitung der Provenienzforschung bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sprechen im Interview über ihre Arbeit und die Schicksale, denen sie begegnen.
© SPK / photothek.net / Thomas Köhler
Die Provenienzforschung in Bezug auf NS-Unrecht ist seit Jahren im Fokus. Entdecken Sie überhaupt noch neue Geschichten oder ist das meiste bereits erforscht?
Andrea Bambi: Nein, es gibt immer wieder neue Fälle, bei denen geklärt werden muss, ob ein Kunstwerk oder eine Sammlung verfolgungsbedingt entzogen wurde. Ich habe bisher auch noch keinen Fall gehabt, der mit einem anderen identisch war. Es sind immer ganz individuelle Schicksale. Die Ähnlichkeiten liegen darin, ob es um Privatpersonen, Sammler*innen oder Kunsthändler*innen geht, aber eigentlich sind die Geschichten und die Wege der Kunstwerke nie deckungsgleich.
Petra Winter: Was sich durchaus wiederholt, sind die Entziehungsstrukturen. Bestimmte Institutionen gingen, wenn sie beteiligt waren, nach einem bestimmten Schema vor. Aber sobald man den Fall und was es für die Betroffenen bedeutete, näher betrachtet, differenziert es sich stark aus, denn dann geht es um individuelle Einzelschicksale. Und auch in den Staatlichen Museen zu Berlin bearbeiten wir immer wieder neue Fälle und begegnen neuen Schicksalen, vor allem deshalb, weil sich die Forschung in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt und verändert hat. Am Anfang beschäftigten Provenienzforscher*innen sich überwiegend mit ganz offensichtlichen Entzugsfällen, wo einschlägige Behörden wie etwa Finanzämter beteiligt waren, die für uns eine Art Marker sind.
Inzwischen erforschen wir unsere Bestände schon seit langem systematisch: Wir schauen uns jede Erwerbung aus dem kritischen Zeitraum 1933-45 und auch die Erwerbungen nach 1945 an, bei denen es einen darunterliegenden NS-Kontext geben könnte. Oft sehen Erwerbungen auf den ersten, zweiten und vielleicht sogar auf den dritten Blick völlig unproblematisch aus. Erst wenn man den Vor-Vorbesitzer ermittelt hat, dem ein Objekt während der NS-Zeit gehörte, kann man vielleicht durch dessen biographischen Hintergrund darauf schließen, dass eventuell Verfolgungszusammenhänge vorliegen.
AB: Wir haben relativ gut Klarheit darüber, was zwischen 1933 und 1945 erworben wurde. Die musealen Erwerbungen nach 1945 sind jedoch auch für uns in München die schwierigste Eigentumslage, weil vieles zu einem Zeitpunkt passiert ist, als das Museum noch nicht Eigentümer war. Für München betrifft das auch die Kunstgegenstände aus den sogenannten Überweisungen aus Staatsbesitz nach 1945. Der Sammlungsaufbau nach 1945 und bis in die 1980er Jahre hinein lief in München auch über Zustiftungen und Schenkungen von Dritten. Wir sind in diesen Fällen also nicht diejenigen, die die Werke in der Zeit des Nationalsozialismus erworben haben und da ist die Dokumentation dementsprechend dünn. Die primären Quellen, die den Erwerb in der NS-Zeit betreffen, liegen uns in diesen Fällen oft nicht vor, sie wurden in der Regel nicht mit der Schenkung überliefert und die Schenker*innen haben beim Kauf nicht darauf geachtet, weil die Umstände andere waren. Es ist in solchen Fällen kaum möglich, in einem ersten Check auszuschließen, dass ein verfolgungsbedingter Entzug vorliegt. Ich denke das ist ein Problem, das alle großen Institutionen haben, die mit vor 1945 entstandener Kunst zu tun haben.
Jetzt startete das neue Erinnerungsprojekt „Kunst, Raub und Rückgabe – Vergessene Lebensgeschichten“. Worum geht es in diesem Projekt und welche Geschichten werden dort erzählt?
PW: In dem Projekt geht es nicht vorrangig um uns als Museen oder um die Objekte, sondern um die Personen und Schicksale, die mit den Objekten verbunden waren und sind. In der Provenienzforschung zur NS-Raubkunst ist es so, dass sich die Recherchen schnell weg vom Objekt bewegen. Natürlich schaut man sich das Objekt an und recherchiert eventuell noch zu den jeweiligen Künstler*innen. Aber meistens besteht die eigentliche Forschungsarbeit in der biografischen Recherche zu den ursprünglichen Vorbesitzer*innen. Dabei kommt so viel persönliches Material zutage, das wir aber für die juristische Entscheidung, ob etwas restituiert werden sollte, nicht brauchen. Wir decken also auf unserem Weg zu einer Entscheidungsfindung sehr viele spannende Schicksale auf, die bisher aber selten an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Hier liegt das Hauptanliegen des Erinnerungsprojektes, diese Geschichten nun zu erzählen, an die Menschen zu erinnern und das Geschehene plastisch darzustellen.
AB: In den Rückerstattungs- und Wiedergutmachungsanträge sprechen diejenigen, die geschädigt wurden, beziehungsweise deren Nachfahren. Und so finden wir in diesen trockenen, bürokratischen Zeugnissen Schilderungen, wie jemand flieht, was die Person verloren hat, aber auch wer umgebracht wurde und Schaden an Leib und Leben erlitten hat. Aus dieser Perspektive wird das Geschehen auf einmal sehr plastisch und entfernt sich vom distanzierten, akademischen Blick, den wir im kunsthistorischen Kontext oft haben. Diese Einblicke sind sehr intim und es sind teilweise wirklich grauenvolle Details, die in diesen Dokumenten festgehalten sind. Gleichzeitig wird aus den Dokumenten deutlich, was die Objekte für die Menschen bedeutet haben. Nicht selten sind es identitätsstiftende Gegenstände und die Menschen versuchen unter allen Umständen, ihr Hab und Gut irgendwie mitzunehmen, zu retten. Oft wird die ganze Dimension dieser Verluste erst deutlich, wenn ein Museum Kontakt zu den betroffenen Familien aufnimmt. Dann zeigt sich, wieviel Bedeutung ein Objekt haben kann, egal ob es ein Silberlöffel ist, ein Bild, eine Skulptur oder eine Vase. Es ist vielleicht das einzige, was an eine Person erinnert. Oft gibt es in den Familien nur noch vage Erzählungen über die Menschen, weil vielleicht nicht mal ein einziges Foto überliefert ist.
Gibt es Geschichten, die Ihnen in diesem Kontext in besonderer Erinnerung geblieben sind, die Sie persönlich berührt haben?
AB: Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem die Erbensuche sehr aufwendig war, weil die Familie über mehrere Kontinente verteilt war. Den in Deutschland lebenden Teil der Familie konnten wir Dank der deutschen Behörden schnell finden. Das war ein Teil der Familie, der sich während der NS-Herrschaft dadurch retten konnte, dass evangelisch geheiratet wurde. Es waren also sogenannte „Mischehen“, die den Verfolgten das Leben gerettet haben. In ihren Familien war die Erinnerung an die jüdischen Wurzeln teilweise gar nicht mehr da, da gab es vielleicht noch Erzählungen über eine Tante, aber mehr nicht. Es war sehr berührend, wie diese Familien dann begonnen haben, ihre Geschichte wiederzuentdecken und aufzuarbeiten.
PW: Unser Arbeitsalltag besteht in erster Linie daraus, zu bestimmten Werken zu recherchieren. Dann liest man aber die Wiedergutmachungs- oder Entschädigungsakten zu den betroffenen Personen und es offenbaren sich furchtbare Details über Flucht, Verlust und gescheiterte Emigrationsversuche. Viele der Menschen, denen die Flucht am Ende doch nicht gelang, kamen ins Konzentrationslager und wurden dort ermordet. Die Behörden zogen dann das ganze Vermögen ein. Was uns bleibt, sind die Listen des gesamten Hausrats, die man als Forscherin durchgeht, auf der Suche nach Kunstwerken, die inzwischen vielleicht hier im Museum sind. Ich erinnere mich an einen spezifischen Fall, wo ich eine solche Liste in den Akten des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg durchging. Das Gemälde, dass wir in unserer Sammlung haben, tauchte dort nicht auf, dafür aber drei andere Werke, die aber nur als „Gemälde“ bezeichnet waren, ohne jegliche weiteren Angaben. Dann sitzt man davor und denkt: Was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht eindeutig sagen, ob unser Gemälde dabei war oder nicht, vielleicht befand es sich nicht mehr im Eigentum der Person, gleichzeitig ist der Verfolgungshintergrund sonnenklar, die Person ist umgekommen, der Staat hat sich alles angeeignet und versteigern lassen. Als Forscherin befinde ich mich dann in einem schwierigen Konflikt, und gleichzeitig ist man emotional davon sehr berührt.
Kommen wir noch mal auf das Erinnerungsprojekt “Kunst, Raub und Rückgabe” zurück. Es ist ein Projekt der SPK und der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Wie kam das Projekt zustande und warum sind diese beiden Institutionen darin gemeinsam engagiert?
AB: Ein Ausgangspunkt war das 20. Jubiläum der Washingtoner Erklärung von 1998 in Berlin, bei dem unter anderem SPK-Präsident Hermann Parzinger und Bernhard Maaz, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, zusammenkamen. Zeitgleich gab es in einem Lüneburger Museum ein großes Treffen von Nachfahren NS-Verfolgter, die sich zu Provenienzfragen getroffen haben. Da ging es um Rückgaben von Alltagsgegenständen, also eher Objekte mit ideellem Wert. Aber dennoch kamen 70 Familienmitglieder in dieses Lüneburger Museum und die Sache wurde plötzlich greifbar. Hermann Parzinger und Bernhard Maaz haben das aufgegriffen und es kam zu dem Entschluss, dass man diese Geschichten erzählen muss. Das war eine der ersten Weichenstellungen.
PW: Neben dieser Episode geht die Initiative auch auf eine gewisse Unzufriedenheit in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung unserer Arbeit zurück. Wir sind uns einig, dass in der breiten Öffentlichkeit und auch in der jüdischen Community zu wenig über die wirklich vielfältigen Bemühungen und die sehr intensiv betriebene Provenienzforschungen an den Museen, die im Übrigen auch sehr häufig zu Restitutionen führen, bekannt ist. Es wurde kürzlich bei unserer Auftaktveranstaltung im Bode-Museum wieder ganz deutlich, dass wir immer noch viel zu wenig über diese Arbeit kommunizieren. Wir müssen viel klarer darstellen: Was beinhaltet die Arbeit und welche Erfolge können wir vorweisen? Und dann liegt es natürlich nahe, auch den nächsten Schritt zu machen und an die Personen zu erinnern, um die es geht, also den Schritt zur Erinnerungskultur. Darin sehe ich den großen Mehrwert des Projekts: dass wir weggehen von dem reinen Berichten über unsere Arbeit und stattdessen zeigen, welche große Bedeutung sie auch weit über die Museen hinaus hat.
Es gibt bald eine Webseite mit Mediathek zu dem Projekt. Was findet man dort und wie werden die Geschichten dort kommuniziert?
AB: Auf der Webseite werden die Filme des Bayerischen Rundfunks und des RBB zu sehen sein und es gibt Links zu deren Mediatheken. Die Sender haben von den Kooperationspartnern ausgewählte und exemplarische Fälle verfilmt und mit Nachfahren der Opfer über die Bedeutung der geraubten Werke gesprochen. Außerdem dient die Webseite dazu, das Thema Kunstraub zu vertiefen. Die Filme sind nur kurze Clips und ein ganzes Leben lässt sich in fünf Minuten nur summarisch darstellen. Die Webseite wird daher die Biografien vertiefen, Entziehungskontexte erklären und außerdem erklären, wie Provenienzforschung funktioniert. Darüber hinaus sollen dort auch Infomaterialien für die Vermittlung bereitstehen, die sich vor allem an Gruppen wenden, die nicht regelmäßig ins Museum kommen.
Wie wichtig sind Museen, ist die auf Kunst fokussierte Perspektive in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess der Aufarbeitung der NS-Verbrechen?
AB: Es gab ja lange die Möglichkeit, Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Je größer der zeitliche Abstand wird, umso mehr geht diese Möglichkeit verloren und wir müssen versuchen, die Erinnerung darüber hinaus am Leben zu halten. Und dazu können wir einen Beitrag leisten, zum Beispiel, indem wir mit unseren bereits erwähnten Filmen die Geschichten erzählen. Das wird die Zeitzeugen natürlich nicht ersetzen können, aber angesichts der aktuellen Entwicklung ist es mehr als notwendig, dass wir mit allen Kräften daran arbeiten, die Erinnerung wach zu halten. Unser Zugang über Kunst und Kulturgut ist vielleicht ein gutes Vehikel, um in ein generelles gesellschaftliches Diskutieren über die Vergangenheit zu kommen.
PW: Die öffentliche Diskussion um Restitutionen und Provenienzen fokussiert in der Regel auf die Kunstwerke. Es wird viel über die Werke geschrieben und nur wenig über die ehemaligen Eigentümer*innen – und wenn dann in der Regel in Bezug auf den Entzugskontext und die Frage, ob ein Museum restituieren soll oder nicht. Aber es geht in den Artikeln selten um die Personen und ihre Familien, besonders um solche, die nicht einschlägig im Kunstmarkt etabliert waren. An all diese Menschen zu erinnern, ob Sammler*in, Gelegenheitskäufer*in oder Laie, soll ein wichtiger Schwerpunkt des Projektes sein. Es ist ja auch ein ganz zufälliger Querschnitt, der uns bei unseren Forschungen begegnet, insofern zeigt das Projekt auch eine ganze Bandbreite der damaligen jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Das ist auch das Reizvolle daran, dass so viele verschiedene Menschen mit ihren Familien und aus verschiedenen Berufen aufscheinen und dass es überhaupt kein homogener Querschnitt ist, der uns begegnet. Ich sehe eine ganze wichtige Aufgabe der Museen darin, dass wir die Vielfalt zeigen. Diesen Schatz an Wissen, den wir haben, müssen wir auf neue Weise in die Öffentlichkeit bringen.