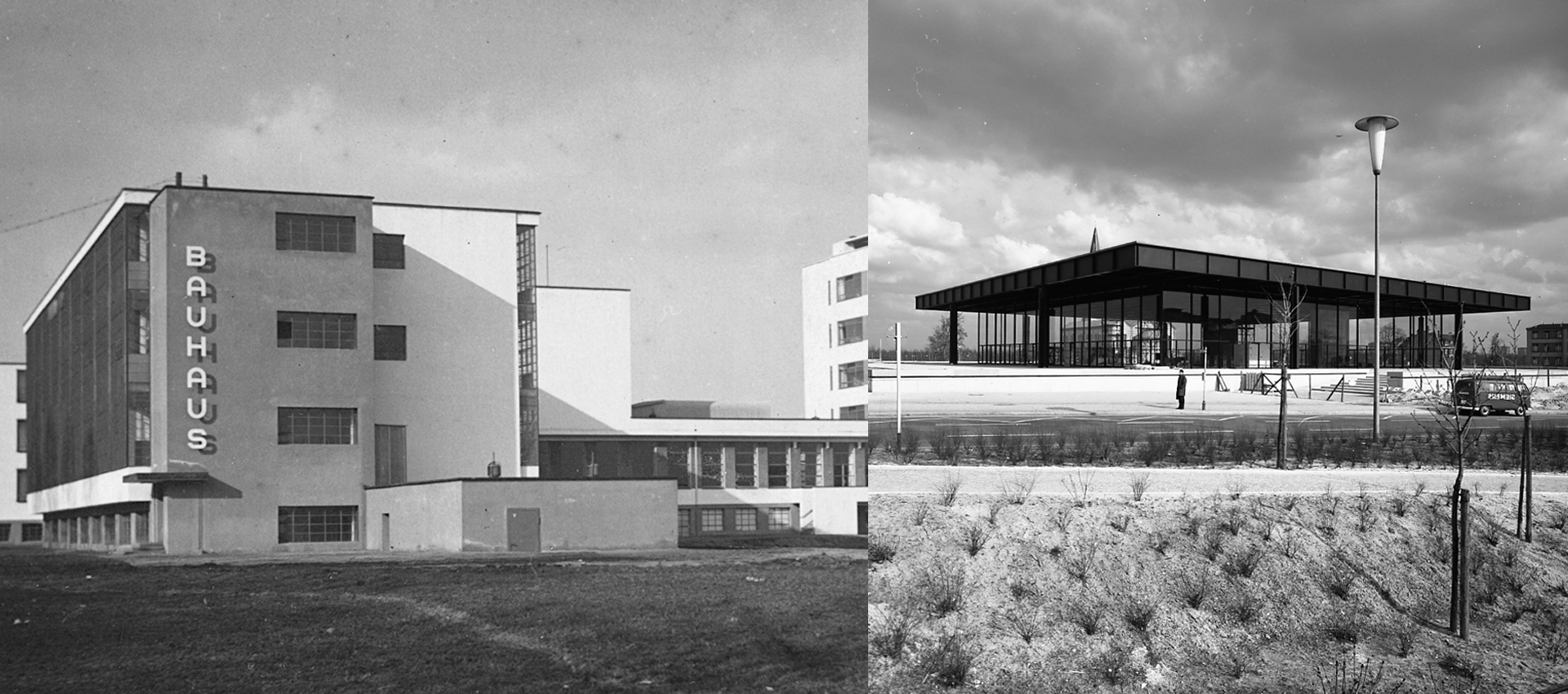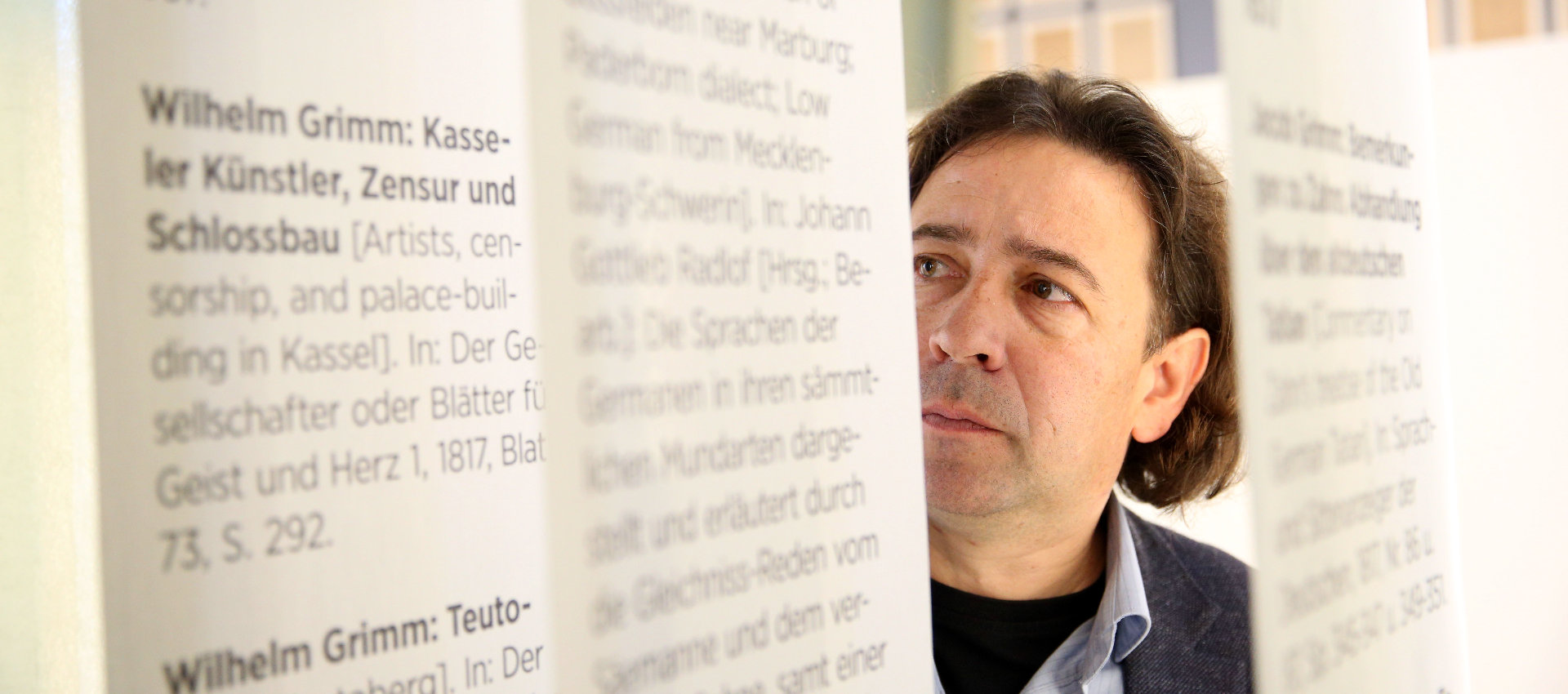Musik kann vieles sein: Flüchtige Kunst, kaum gehört und schon verklungen. Sinnlich und greifbar beim Erlernen eines Instruments. Tanzbar und in direktem Kontakt mit unseren Emotionen im Berliner Clubleben. Historisches Kulturerbe und intellektuelle Höchstleistung bei der Konstruktion und Analyse musikalischer Tiefenstrukturen.
Genau in der Mitte dieser vielfältigen Erscheinungsformen befindet sich das Forschungsprojekt sense:ability – musikbezogener Wissenstransfer zwischen Materialität und Virtualität. Angesiedelt am Staatlichen Institut für Musikforschung (SIM), nimmt es unterschiedlichste Formen des musikbezogenen Wissenstransfers in den Blick.
Das Projekt beginnt mit dem analysierenden Blick auf das, was am SIM bereits vorhanden ist und weitet dann die Perspektive auf das, was möglich wäre. Am Ende soll ein Ideenbuch mit neuen Formaten musikbezogenen Wissenstransfers entstehen, das allen zur Verfügung steht. Das kann nur gelingen, wenn das SIM von den Menschen lernt, die Musik und die damit zusammenhängenden Themen wahrnehmen und wertschätzen.
Folgerichtig begleiten verschiedene Formate der Besucher*innenforschung das gesamte Projekt. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, dem Institut für Museumsforschung (IfM) und den Forschern Wolfgang Kesselheim und Sergey Mukhametov, wird erforscht, wie die Menschen das Museum nutzen und was sich unser Publikum wünscht. Dabei interessiert besonders das Zusammenspiel von sensorischer Erfahrung, emotionaler Beteiligung und sozialer Interaktion.
Voneinander lernen und gemeinsam Ideen entwickeln
Wissenstransfer wird schon lange nicht mehr als hierarchische Einbahnstraße gesehen – auf der einen Seite die Expert*innen mit Deutungshoheit, auf der anderen Empfänger*innen, die mehr oder weniger dankbar die vorgetragenen Inhalte aufnehmen. sense:ability versteht Wissenstransfer als dynamischen Austauschprozess zwischen verschiedenen Akteur*innen.
Idealerweise lernt man voneinander und entwickelt gemeinsam neue Ideen. Bei zwei Strategie-Workshops im März 2024 legten Mitarbeitende des SIM unter anderem gemeinsam drei Zielgruppen für das Projekt fest: Die vielschichtige Elektro-Szene, Young Adults und die wissenschaftlichen Communities. Mit der Einladung von Fokusgruppen, die die ausgewählten Zielgruppen repräsentieren, wollen die Beteiligten Raum für einen Austausch auf Augenhöhe schaffen.
Wie kann das aussehen? Zunächst sollen die Gäste Gelegenheit haben, das Haus kennenzulernen. Bei diesen Veranstaltungen sind Mitarbeitende aller Abteilungen als persönliche Gastgeber*innen präsent. Neben festgelegten Programmpunkten wird es auch offene Zeiträume geben, in denen die Gäste nach individuellen Impulsen auf Entdeckungsreise durch das SIM gehen können.
Das IfM begleitet diese Veranstaltung durch die Methode der teilnehmenden Beobachtung. Besonders die Verhaltensweisen der Fokusgruppenteilnehmer*innen, die Interaktion untereinander oder mit den Mitarbeitenden des SIM sind spannend. Diese Beobachtungen werden strukturiert gesammelt und dokumentiert.
Zudem werden im Nachgang der Veranstaltungen leitfadengestützte Einzelinterviews mit allen Teilnehmenden geführt, um deren Feedback zu erfassen. Wenn auf Grundlage dieser Daten im weiteren Projektverlauf neue Formate des musikbezogenen Wissenstransfers entwickelt werden, sind die Fokusgruppen eingeladen, ihre Ideen und Impulse mit einzubringen.
Strichmännchen und Tiefensensoren

Natürlich wollen die Projektverantwortlichen gerne mehr darüber wissen, wie die Besucher*innen das Musikinstrumenten-Museum im „Normalbetrieb“ erleben. Die Flöten aus dem Besitz Friedrich II. und das Reisecembalo von Königin Sophie Charlotte gehören zu den Highlights der ständigen Ausstellung. Aber sehen das die Besucher*innen auch so? Welchen Weg wählen sie durch das Museum, wo bleiben sie stehen und tauschen sich zu Exponaten aus?
Wolfgang Kesselheim von der Universität Greifswald und Sergey Mukhametov von der Technischen Universität Kaiserslautern planen den Aufbau von Kinect-Kameras für eine Langzeitmessung mit Tiefensensoren in der Hohenzollern-Abteilung des Musikinstrumenten-Museums. Als Kooperationspartner von sense:ability haben beide Erfahrung mit dieser Art von Besucher*innentracking.
Mithilfe von Infrarotstrahlern werden Tiefenbilder erzeugt, die die Grundstruktur menschlicher Körper anhand der Gelenkpunkte erkennen und auch Körperhaltungen abbilden können. Es sind personenunabhängige Daten: Zu sehen sind nur skelettartige Posen, die an frühkindliche Strichmännchen-Zeichnungen erinnern. Von der Datenanalyse gegen Ende des Projekts erhoffen sie sich Einblicke in die Laufwege des Publikums. Gibt es hochfrequentierte und wenig nachgefragte Bereiche? Vor welchen Exponaten bleiben die Besucher*innen besonders häufig stehen, welche Exponate werden dagegen von vielen übersehen?
Besonders interessant: Aus den Skelettdaten lässt sich erkennen, wann sich Besucher*innen vor einem Exponat miteinander im Gespräch befunden haben. Wenn Menschen miteinander reden, nehmen sie typische Positionen ein, die von dem Trackingsystem wiedererkannt werden können. Wenn dann beispielsweise noch Zeigegesten auf das Exponat hinzukommen oder die Besucher*innen ihre Oberkörper immer wieder von ihren Gesprächspartner*innen auf das Exponat gerichtet haben, kann man mit ziemlicher Sicherheit wissen, dass sich das Gespräch um das Exponat gedreht hat.
So kann das Tracking aufzeigen, welche der Exponate die Besucher*innen am stärksten zu Gesprächen anregen. Spannende Fragen, denn die Forschung zeigt, dass Erfahrungen im Museum sehr oft in der sozialen Interaktion mit den Mitbesucher*innen entstehen!
Emotionen und Geistesblitze
Museen sind also soziale Räume, in denen Menschen und Objekte sich begegnen und aufeinander wirken. Steht man gemeinsam mit einer Begleitung vor einem Exponat, denkt man darüber nach, entwickelt eine Meinung und tauscht sich eventuell dazu aus. Emotionen gehören ebenso zum Museumsbesuch wie gedankliche Prozesse. Umso mehr gilt dies für ein Musikinstrumenten-Museum: Melodien und Harmonien können rühren oder aufregen, bestimmte Klänge liebt oder hasst man geradezu.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Glasharmonika. Dieses von Benjamin Franklin um 1761 entwickelte Instrument faszinierte die empfindsamen Menschen der frühen Biedermeierepoche durch seinen besonderen „gläsernen“ Klang: 24 fast halbkugelförmige Glasschalen (Kalotten) sind von links nach rechts in abnehmender Größe an einer Achse angeordnet. Diese Glasschalen drehen sich und werden gleichzeitig mit vom Wasser befeuchteten Fingern feinfühlig berührt. So entsteht ein ätherischer Klang, der an- und abschwellen kann und dem geradezu fantastische Wirkungsweisen zugeschrieben wurden.
Der Dichter und Freigeist Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791) beschreibt in seinen "Ideen zur Ästhetik der Tonkunst" mit präziser Wortwahl seine Einschätzung dieses Instruments: "Der gefühlvolle Spieler ist für dies Instrument ganz geschaffen. Wenn Herzblut von den Spitzen seiner Finger träuft; wenn jede Note seines Vortrags Pulsschlag ist (…) dann nähere er sich diesem Instrument und spiele." Allerdings rufe der "ewig heulende, klagende Gräberton" Wehmut und Melancholie hervor.
Der umstrittene Arzt und Erfinder des "animalischen Magnetismus" Franz Anton Mesmer (1734–1815) glaubte an die Heilkraft der Glasharmonika und nutzte sie in Wien unter anderem zur therapeutischen "Nachbehandlung und Entspannung" seiner Patient*innen.
Der Musiker und Komponist Karl Leopold Röllig (1754–1804) wiederum lobt in seiner kurzen Schrift "Über die Harmonika" ihre Fähigkeit, "stets den höchsten Grad rührender Leidenschaften" auszudrücken. Gleichzeitig warnt er aber auch vor dem unbedachten Spielen des Instruments: "Denn so unnachahmlich schön, - so höchst vollkommen der Ton der Harmonika ist (…) so höchst gefährlich kann sie werden" und Krankheiten erzeugen, die "furchtbar, ja sogar tödtlich" enden könnten.
Wie empfinden heutige Ohren den Klang der Glasharmonika?
Die originalen Klänge der kostbaren Glasharmonika (MIM-Kat. Nr. 812) des Musikinstrumenten-Museums wurden gesampelt und können an der nebenstehenden Interaktionsstation von den Besucher*innen ausprobiert werden. Findet man heute den charakteristischen Klang der Glasharmonika beruhigend, langweilig oder unheimlich? Macht es einen Unterschied, ob man nur das Original betrachtet, oder selbst aktiv wird?
Gemeinsam mit dem Institut für Museumsforschung werden entsprechende Befragungen stattfinden. Dabei wird eine auf die Museumssituation abgestimmte Kurzfassung des "Aesthetic Emotions Scale" (AESTHEMOS) genauso genutzt werden, wie Tiefeninterviews oder andere Methoden der qualitativen Besucher*innenforschung.

Im Obergeschoss des Museums kommen auch Fans elektronischer Musikinstrumente im MIM auf ihre Kosten. Das Trautonium, der EMS Synthesizer VCS 3, das Mellotron oder die legendäre LinnDrum: Die Anziehungskraft dieser Instrumente wurde bereits beim Publikumsandrang der Sonderausstellung "Good Vibrations. Eine Geschichte der elektronischen Musikinstrumente" im Jahr 2017 deutlich.
Hippe Menschen drängelten sich durchs Haus, Größen wie Tangerine Dream oder Ellen Alien eingeschlossen. Nachdem gerade der Berliner Techno zum Teil des UNESCO Kulturerbes erklärt wurde, ist die Bedeutung dieser Sammlung für die gesellschaftliche Relevanz des Hauses deutlicher denn je.
Entsprechend möchte das SIM herausfinden, wie sich die Besucher*innen in dieser Abteilung verhalten, was sie interessiert und was sie sich wünschen. Auch hier sind neben der Beobachtung des Besucher*innenverhaltens in Zusammenarbeit mit dem IfM leitfadengestützte Interviews geplant. Diese Daten sollen einerseits die Besucher*innenperspektive sichtbarer machen, andererseits auch in die Überlegungen zur mittelfristigen Neugestaltung des Bereichs der elektronischen Musikinstrumente einfließen.
Ausblick
Auf Grundlage der Arbeit mit den Fokusgruppen, der internen Strategie-Workshops und der in den Besucher*innenbefragungen erhobenen Daten werden gemeinsam neue Formate des musikbezogenen Wissenstransfers konzipiert. Eines dieser Formate wird dann in einem möglichst partizipativen Prozess ausgewählt und – zumindest in der Grundstruktur – innerhalb des Projektzeitraums umgesetzt. Eines jedoch ist jetzt schon sicher: Der erhobene "Datenschatz" bleibt auch über den Zeitraum des Projekts erhalten und wird langfristig für Erkenntnisgewinn sorgen.